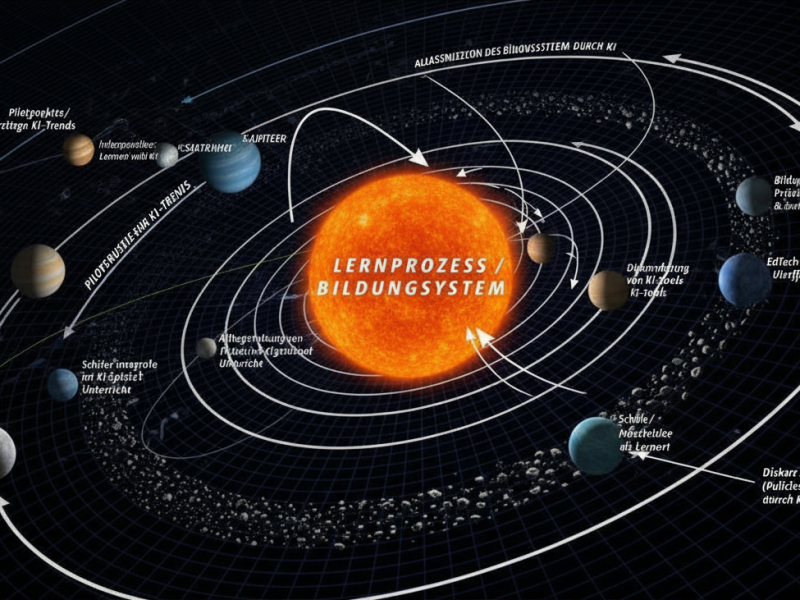In den letzten Monaten habe ich mich intensiv mit der Begriffswelt und methodischen Implikationen der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) befasst, und wie diese für die hochschul- und digitalisierungsbezogene Bildungsforschung angewendet werden können. Das Interessante an der ANT ist aus meiner Sicht, dass sich „Standardprobleme“ in der Praxis und Forschung zu Bildungstechnologien, Mediendidaktik und angrenzenden Bereichen in einem neuen Licht darstellen lassen. Das, was von der ANT in der Regel hängenbleibt, ist ja die Ausweitung des „Akteur“-Begriffs auf nicht-menschliche Entitäten. Bruno Latour hat dies anhand von Bremsschwellen auf der Straße, Hotelschlüsselanhängern und Drehtüren beschrieben, Michael Callon hat in seiner Analyse den nordatlantischen Kammmuscheln zu bleibendem Ruhm in der ANT-Community verholfen. Es ist überaus spannend, die Welt „ANTish“ zu betrachten, an jeder Straßenecke, in jedem Laden, in jeder Hochschule und in jedem Text lassen sich die Verknüpfung und Entfaltung von Aktoren beobachten.
ANT und Bildungstechnologie
Für die Beschäftigung mit Bildungstechnologien bietet sich ANT geradezu an, weil hier die soziotechnischen Verwicklungen besonders augenfällig werden. Allerdings steckt in der ANT mehr drin, als nur die Geräte, Medientechnologien und technologische Infrastrukturen auf ihre (sozialen) Wirkungsweisen hin zu untersuchen. Aus meiner Sicht liegen die spannenderen Momente darin, die abstrakten Entitäten, mit denen wir gewohnt sind, zu hantieren, also auch Modelle, Konzepte und Theorien wie „Wissenschaft“, „Lern-Management-System“ oder „Didaktik“ als Netzwerkeffekte zu interpretieren. Und zwar Effekte, die sich nur ergeben können, wenn viele Akteure sich auf stabile Verbindungen einigen können, was wiederum nur gelingt, wenn gegenständliche, „nicht-soziale“ Entitäten einbezogen sind. Es geht darum, diesen Übersetzungen nachzuspüren, die genauso für ein PDF-Skript in Moodle zur Wirkung kommen, wie bei einem ChatBot mit LLM-Anbindung. Dies alles sind keine geheimnisvollen oder auch nur neuen Sichtweisen, schließlich sind wir es gewohnt, in einer Bedeutungswelt zu leben, die sich aus Menschen, Dingen und Beziehungen zusammensetzt. Aber es ist ein Weg, die Komplexität der Dinge besser zu erfassen. Dazu fokussiert die ANT, was diese Akteure „machen“: Wann und wie wird das PDF heruntergeladen, ausgedruckt, markiert, kopiert und gespeichert? Wird es mit einer Volltextsuche bearbeitet? Ist das mit diesem PDF möglich? Was „macht“ das PDF-Skript im Lehr-Lern-Setting?
ANT und generische KI
ANT will diese Bewegungen und Transformationen von Dingen und Akteur*innen nachverfolgen. Auf die generische KI übertragen, bedeutet diese Sichtweise bspw. das „das LLM“, „die genAI“ gar nicht vollständig beschrieben werden kann, wenn die vielen Interaktionen nicht nachverfolgt werden, in denen unser Begriff der genAI sich überhaupt erst etabliert. Die Rollenmodelle („Werkzeug oder Partnerin“) die zur Zeit in Bezug auf die genAI diskutiert werden, sind spekulativ und treffen – wie sich die meisten Autorinnen eingestehen – die Praxis nur zum Teil, weil sie sich dort vermischen, in unterschiedlichen Settings und mit unterschiedlichen Anwendungen stattfinden, die sich bunt abwechseln können. Der ChatBot macht etwas mit den Nutzer*innen, spiegelt ihre eigene Rollenvorstellung und verändert diese, ist ein fluider Aktor zwischen anderen fluiden Aktoren1 . Daher, und das ist die schlechte Nachricht, eignet sich ANT wenig dafür, Zukünfte zu entwerfen und sehr viel besser, Vorgänge ex post zu beschreiben. Aber sie ist gut dafür geeignet, die Vorgänge und Entitäten zu analysieren und kann daher Hinweise darauf geben, wie sich Dinge nicht entwickeln können.
ANT liefert ergänzende Einsichten
ANT ist keine „neue Theorie“. Wer praxeologisch, diskurstheoretisch, systemtheoretisch, sozialkonstruktivistisch oder historisch-materialistisch denkt, braucht hier keine Konkurrenz zu vermuten (obwohl Bruno Latour äußerst kritisch gegen die zeitgenössische Soziologie argumentierte…). Sie sollte eher als eine Methode betrachtet werden, die Realität ergänzend zu beschreiben. Wer sich aber darauf einlässt, kann mit neuen und überraschenden Einsichten belohnt werden. In meinem Blogpost hatte ich beschrieben, warum und wie ich zur ANT gekommen bin. Jetzt möchte ich veröffentlichen, welche Eckpunkte ich für meine Arbeiten mit der ANT formuliert habe. Es ist eine recht überschaubare Liste mit Grundsätzen, die sich viel, viel weiter ausdifferenzieren und mit Querverweisen versehen ließe. Aber sie sollte geeignet sein, als Orientierung und methodische Hinweisgeberin zu dienen.
Grundsätze der ANT
Kennzeichnend für die ANT sind eine Reihe von Grundsätzen, die ich mir folgendermaßen zusammengefasst habe:
- Soziale Phänomene entstehen aus einer Assoziation gleichberechtigter Akteure. ANT verfolgt ein Verständnis, das sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Akteure als gleichberechtigte („symmetrische“) Elemente eines Wirkungszusammenhangs betrachtet. Alle Akteure (im Folgenden werde ich von „Aktoren“ sprechen2 ) sind, unabhängig von ihrer Natur, an der Konstitution und Stabilisierung eines sozialen Phänomens beteiligt und müssen gleichwertig in der Analyse berücksichtigt werden.
- Nicht-menschliche Aktoren sind vielfältig. Nicht-menschliche Aktoren können Technologien, Geräte, Artefakte, Tiere, Systeme, Theorien, Modelle usw. sein. Entscheidend für den Aktor-Status in einem konkreten Zusammenhang ist, dass das betreffende Element „einen Unterschied macht“, also auf andere Aktoren und den Zusammenhang einwirkt. Das gilt im Übrigen entsprechend auch für Menschen.
- Jeder Aktor ist ein Netzwerk und umgekehrt. Jeder Aktor kann als
Teil einesZusammenhang von Aktoren („Netzwerk“) interpretiert werden. Jedes Netzwerk kann entsprechend als ein Aktor interpretiert werden. Es kann also generell auch von einem „Aktoren-Netzwerk“ (actor-network) gesprochen werden.
- Ein Aktoren-Netzwerk kann als Blackbox auftreten. Ein konkretes Aktoren-Netzwerk kann als „Blackbox“ betrachtet werden, wenn es eine stabile, prognostizierbare Funktion erfüllt. Die innere Struktur der Blackbox interessiert nicht, solange die Funktion erfüllt wird.
- Die Welt der Aktoren ist flach. Im Netzwerk der Aktoren ergeben sich Kategorien und Hierarchisierungen nicht von selbst. Der Weg vom individuellen Aktor hin zu Ontologien, Kategorien, Systemen oder zu anderen Abstraktionen führt über einzelne Schritte, Objektivierungen oder Teil-Handlungen, die nachvollzogen werden können.
- Folgt den Aktoren! Das epistemische Herangehen der ANT besteht darin, Aktoren zu identifizieren und nachzuverfolgen, wie sich deren Wirkungszusammenhänge entfalten, das heißt, wie diese mit anderen Aktoren verknüpft sind und was zwischen ihnen geschieht. Das Netzwerk ist die Bewegungs- und Darstellungsform dieser Zusammenhänge und „nicht die Sache selbst“ (Latour, 2010, S. 228).
- Stabilität ist die Ausnahme. Die Welt der Aktor-Netzwerke ist in Bewegung. Aktoren erhalten ihre eigene Identität und Stabilität, indem sie im Zusammenwirken mit anderen Aktoren ein stabiles Ganzes erzeugen und aufrechterhalten. Dieser Prozess kommt nicht zur Ruhe, sondern nur zu einem dynamischen Gleichgewicht, das kontinuierliche Aktivität erfordert.
Let’s talk ANT!
Literaturverzeichnis
- Belliger, A., Krieger, D., Herber, E., & Waba, S. (2013). Die Akteur-Netzwerk-Theorie. In M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), L3T.
- Belliger, A., & Krieger, D. J. (2006). Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), ANThology: Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie (S. 13–50). Transcript-Verl.
- Callon, M. (1984). Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. The Sociological Review, 32(1_suppl), 196–233. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1984.tb00113.x
- Callon, M. (2006). Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung: Die Domestikation der Kammmuscheln und der Fischer der St. Brieuc-Bucht. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), ANThology: Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie (S. 135–174). Transcript-Verl.
- Dimai, B. (2012). Innovation macht Schule. Eine Analyse aus der Perspektive der Akteur-Netzwerk Theorie. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94364-0
- Fenwick, T. J., & Edwards, R. (Hrsg.). (2012). Researching education through actor-network theory. Wiley – Blackwell; Kindle.
- Latour, B. (2006). Technik ist stabilisierte Gesellschaft. In A. Belliger & D. J. Krieger (Hrsg.), ANThology: Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie (S. 369–398). Transcript-Verl.
- Latour, B. (2010). Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie (G. Roßler, Hrsg.). Suhrkamp.
- Niemeyer, J., Tillmann, A., & Eichhorn, M. (2019). Digitalisierungsprozesse an Hochschulen – der Blick der Akteur-Netzwerk-Theorie. In N. Pinkwart, J. Konert, & Gesellschaft für Informatik (Hrsg.), DeLFI 2019 (S. 85–90). DeLFI, Bonn. Gesellschaft für Informatik e. V. (GI).
- Reckwitz, A. (2014). Die Materialisierung der Kultur. In F. Elias, A. Franz, H. Murmann, & U. W. Weiser (Hrsg.), Praxeologie (S. 13–28). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110370188.13
- Röhl, T. (2015). Auffordern. Postphänomenologische Überlegungen zur Materialität schulischen Unterrichtens. In T. Alkemeyer, H. Kalthoff, & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), Bildungspraxis (S. 233–260). Velbrück Wissenschaft. https://doi.org/10.5771/9783845277349-233
- Schimank, U. (2007). Handeln und Strukturen: Einführung in die akteurtheoretische Soziologie. Juventa-Verl. https://opac.ub.uni-potsdam.de:443/DB=1/PPNSET?PPN=521362741
- Schulz-Schaeffer, I. (2012). Akteur-Netzwerk-Theorie: Zur Ko-Konstitution von Gesellschaft, Natur und Technik. In J. Weyer (Hrsg.), Soziale Netzwerke (S. 275–300). Oldenbourg Wissenschaftsverlag. https://doi.org/10.1524/9783486709667.275
- Allerdings scheinen mir die vielen Ansätze der Human-AI-Hybrids/Mensch-Maschinen-Hybriden vielfach in diese Richtung zu gehen, d.h. sehen keine zwei Entitäten, die irgendwie zusammenkommen, sondern bereits eine dritte Entität am entstehen [↩]
- In der Literatur zur Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) werden die Begriffe „Akteur“ und „Aktant“ unterschiedlich verwendet. In den frühen ANT-Texten umfasst der Begriff „Akteur“ meist sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Beteiligte. Später wurde der Begriff „Aktant“ eingeführt und in einigen Publikationen spezifisch für nicht-menschliche Entitäten verwendet. Um die Begriffsverwirrung zu verringern und die Bedeutung des „ANT-Akteurs“ von dessen Nutzung in der akteurtheoretischen Soziologie (Schimank 2007) eindeutig abzugrenzen, verwende ich den Begriff „Aktor“ (englisch: „actor“) und spreche von „Akteur*innen“, wenn ausschließlich menschliche Beteiligte gemeint sind. [↩]